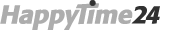NEWS
"Wer bin ich, wenn ich nicht mehr weiĆ, wer ich bin?"

"Wer bin ich, wenn ich nicht mehr weiß, wer ich bin?"
Eine badische Spurensuche nach der deutschen Seele zwischen Schwarzwald und Rhein
Essay von Andreas Peter Geng (apg) im Juli 2025
Warum zucken wir zusammen, wenn jemand fragt: "Bist du stolz, ein Deutscher zu sein?" Warum fühlt sich die Frage nach unseren Wurzeln wie ein Minenfeld an? Ein Ortenauer Journalist begibt sich auf eine überraschende Reise zu den verborgenen Schätzen unserer Identität – und entdeckt dabei, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, uns zu erinnern, wer wir wirklich sind. Eine Geschichte über Manipulation, Heilung und die erstaunliche Kraft echter Gemeinschaft.
I. Prolog: Die unbequemen Fragen
Darf ich Sie etwas fragen? Etwas, das Sie vielleicht irritiert, möglicherweise sogar ärgert?
Bist du stolz, ein Deutscher zu sein? Fühlst du dich deinen Ahnen verbunden? Ehrst du die Gefallenen deiner Familie – auch wenn sie auf der "falschen" Seite kämpften? Glaubst du an so etwas wie eine deutsche Seele?
Wenn Sie jetzt ein ungutes Gefühl haben, sind Sie nicht allein. Neulich, beim Bäcker in Oberkirch, erzählte mir eine ältere Dame von ihrem Enkel. Er studiere Geschichte in Freiburg und habe sie gefragt, ob sie ihm von seinem Urgroßvater erzählen könne. "Ich wusste nicht, was ich sagen sollte", flüsterte sie und schaute sich um, als könnte jemand mithören. "Der ist doch im Krieg gefallen. Darüber spricht man nicht."
Darüber spricht man nicht. Dieser Satz hallt durch Generationen deutscher Familien. Von Kehl bis Wolfach, von Offenburg bis in die Täler des Schwarzwalds. Wir Badener, einst bekannt für unseren Frohsinn und unsere Offenheit, verstummen bei den einfachsten Fragen nach unserer Herkunft.
Aber warum? Warum können ein Franzose, ein Italiener, ein Pole ohne Zögern sagen: "Ja, ich bin stolz auf mein Land, meine Geschichte, meine Vorfahren" – während wir Deutsche reflexartig zusammenzucken? Warum fühlt sich die Frage nach unseren Wurzeln an wie ein Gang durchs Minenfeld?
Die Antwort ist verstörender, als Sie vielleicht denken. Und sie beginnt nicht 1933 oder 1945, sondern 1943 in einem unscheinbaren englischen Landsitz namens Bletchley Park.
Foto KI - Verschleiert im Dunkel der Vergangenheit?
II. Die gestohlene Identität
Bevor Sie jetzt denken: "Oh nein, nicht schon wieder so eine Verschwörungstheorie!" – lassen Sie mich etwas klarstellen. Nach fast zehn Jahren auf Sizilien, wo ich die ungebrochene Verbundenheit der Italiener mit ihrer Geschichte erlebte, kam ich mit einem Außenblick zurück. Und was ich sah, irritierte mich zutiefst. Nein, ich bin kein Revisionist, kein Rechter, kein Ewiggestriger. Ich bin Journalist, und ich stelle Fragen.
1943, während in Bletchley Park die deutsche Enigma-Verschlüsselung geknackt wurde, trafen sich dort etwa 200 der brillantesten Köpfe der Alliierten. Ihr Auftrag ging weit über Kryptographie hinaus. Sie sollten einen Plan entwickeln, wie man die deutsche Mentalität nachhaltig verändern könnte. Nicht für Jahre – für Generationen.
Ich weiß, das klingt ungeheuerlich. Bleiben Sie bei mir. Die Dokumente existieren, sind einsehbar, keine Geheimsache. William Toel, ein amerikanischer Ökonom und – man höre und staune – Liebhaber der deutschen Kultur, hat sie jahrzehntelang studiert. Was er fand, verschlägt einem den Atem.
Die Strategen identifizierten "sieben Säulen des Deutschtums", die es zu zerstören galt:
- Die Verbindung zu den Ahnen kappen
- Den Stolz auf deutsche Errungenschaften eliminieren
- Die Überzeugung einpflanzen, die deutsche Seele sei von Grund auf böse
- Den Glauben zerstören, Gott stehe auf deutscher Seite
- Die Trauer um eigene Verluste verbieten
- Die Geschichte umschreiben
- Die traditionellen Familienstrukturen auflösen
Moment mal, werden Sie sagen. Das ist doch Propaganda! Genau das dachte ich auch. Bis ich begann, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Warum dürfen wir nicht um unsere Großväter trauern? Warum kennen wir Goethes Faust, aber nicht mehr "Am Brunnen vor dem Tore"? Warum schämen wir uns für Tugenden wie Pünktlichkeit, Ordnung, Fleiß – während sie in Japan als vorbildlich gelten?
Verstehen Sie mich nicht falsch: Die Verbrechen des Nationalsozialismus waren real, unentschuldbar, monströs. Daran gibt es nichts zu deuteln. Aber – und jetzt wird es heikel – wurde die berechtigte Aufarbeitung dieser zwölf dunklen Jahre instrumentalisiert, um etwas viel Größeres zu zerstören? Die deutsche Identität an sich?
III. Die Umerziehung: Eine badische Perspektive
Jetzt werden einige von Ihnen denken: "Was hat das mit uns hier in Baden zu tun?" Nun, die amerikanische Besatzungszone, zu der Baden gehörte, war tatsächlich ein Schwerpunkt der "Re-education".
Caspar von Schrenck-Notzing dokumentierte in seinem Werk "Charakterwäsche" detailliert die Methoden der Umerziehung. Er zitiert aus den Direktiven der amerikanischen Militärregierung, die explizit forderten, das deutsche Bildungswesen von Grund auf zu reformieren. Nicht nur Nazi-Ideologie sollte entfernt werden - was absolut notwendig war - sondern auch Jahrhunderte alte Traditionen wurden unter Generalverdacht gestellt.
Nach fast zehn Jahren auf Sizilien fiel mir bei meiner Rückkehr etwas auf: Während die Sizilianer ihre alten Lieder ohne Scham singen und ihre Geschichte - die wahrlich nicht nur ruhmreich war - mit Selbstverständlichkeit annehmen, herrscht bei uns eine merkwürdige Stille über alles, was vor 1945 war.
Die Historikerin Dagmar Bussiek beschreibt in ihren Arbeiten, wie systematisch nicht nur Schulbücher ausgetauscht, sondern ganze Bibliotheken "gesäubert" wurden. Theodor Adornos berühmtes Diktum "Es gibt kein richtiges Leben im falschen" wurde zur Blaupause einer Kulturkritik, die letztlich alles Deutsche unter Generalverdacht stellte.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Die Entnazifizierung war notwendig, die Demokratisierung ein Segen. Aber ging man zu weit? Wurde das Kind mit dem Bade ausgeschüttet?
Der Psychologe Alexander Mitscherlich sprach schon 1967 von der "Unfähigkeit zu trauern" der Deutschen. Aber durfte man denn trauern? Um gefallene Väter, zerbombte Städte, verlorene Heimat? Oder war das schon "revanchistisch"?
Diese Fragen zu stellen ist heikel, ich weiß. Aber wenn wir sie nicht stellen, wer dann?
IV. Was war "deutsch" vor der Manipulation?
Was also ging verloren? Was war dieses "Deutschsein", bevor es zum Unwort wurde? Hier wird es spannend, denn die Antwort ist vielschichtiger, als man denkt.
Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: der deutschen Romantik. E.T.A. Hoffmann, Caspar David Friedrich, die Gebrüder Grimm – sie alle verkörperten eine besondere Art, die Welt zu sehen. Eine Mischung aus Naturverbundenheit, Innerlichkeit und der Suche nach dem Transzendenten. Der deutsche Wald war nicht nur Holzlieferant, sondern Seelenlandschaft. "Waldeinsamkeit" – versuchen Sie mal, dieses Wort ins Englische zu übersetzen.
Die vielgeschmähten "preußischen Tugenden"? Schauen wir genauer hin. Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit, Bescheidenheit, Sparsamkeit – auf Sizilien nannte man mich scherzhaft "il tedesco puntuale", den pünktlichen Deutschen. Aber wissen Sie was? Sie mochten es. Es gab Sicherheit, Vertrauen. "Mit Andreas kann man rechnen", hieß es. War das wirklich so schlecht?
Foto KI - Wer waren unsere Vorfahren wirklich?
Wir Badener hatten unsere eigene Variante: "Liberalitas et Concordia" – Freiheit und Eintracht. Die badische Verfassung von 1818 war eine der fortschrittlichsten ihrer Zeit. Karl Friedrich von Baden korrespondierte mit Voltaire. Wir waren weltoffen UND heimatverbunden. Das war kein Widerspruch, sondern unsere Stärke.
Die Märchen der Gebrüder Grimm – heute oft als "grausam" verschrien – waren Wegweiser durchs Leben. Sie lehrten: Das Gute siegt, aber der Weg ist steinig. Mut wird belohnt, Faulheit bestraft. Einfache Wahrheiten? Vielleicht. Aber Wahrheiten, die Generationen Orientierung gaben.
Und die Lieder! "Kein schöner Land in dieser Zeit", "Die Gedanken sind frei", "Guten Abend, gut' Nacht" – sie waren mehr als Unterhaltung. Sie waren kollektives Gedächtnis, emotionale Heimat. Hermann Hesse schrieb: "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne." Das ist zutiefst deutsch: dieser Glaube an Neuanfänge, an Verwandlung, an die Kraft des Geistes.
Die deutsche Gründlichkeit? In Sizilien richtete ich ein braches Grundstück her. Die Nachbarn staunten über meine Detailversessenheit. "Perché così preciso?" – Warum so genau? Aber am Ende waren sie stolz auf das Ergebnis. "Lavoro tedesco" – deutsche Arbeit – wurde zum Qualitätssiegel.
Ich sage nicht, dass alles Gold war, was glänzte. Der Kadavergehorsam, der Untertanengeist, die Überheblichkeit – all das gab es auch. Aber warum schütten wir das Kind mit dem Bade aus? Warum können wir nicht differenzieren zwischen dem, was bewahrenswert ist, und dem, was überwunden gehört?
Die Japaner haben es vorgemacht: Nach ihrer Niederlage 1945 bewahrten sie ihre kulturelle Identität und verbanden sie mit demokratischen Werten. Warum gelang uns das nicht
V. Die neurobiologische Perspektive
An dieser Stelle werden manche denken: "Jetzt wird's esoterisch." Falsch. Jetzt wird's wissenschaftlich. Gerald Hüther, renommierter Neurobiologe aus Göttingen, hat etwas Fundamentales über uns Menschen herausgefunden: Wir haben zwei Grundbedürfnisse – Zugehörigkeit und Autonomie. Verbundenheit und Freiheit. Beides gleichzeitig.
Was passiert, wenn man einem Volk systematisch die Zugehörigkeit nimmt? Wenn man ihm einredet, seine Vorfahren seien durch die Bank Verbrecher gewesen? Wenn jede Tradition verdächtig ist? Hüther würde vielleicht sagen: Es entsteht eine kollektive Traumatisierung.
"Traumata werden über Generationen weitergegeben", erklärt die Epigenetik. Nicht nur psychisch, sondern biologisch. Die Kriegsenkel-Generation, geboren in den 60ern und 70ern, trägt die unverarbeiteten Ängste ihrer Eltern in sich. Sabine Bode hat das in ihren Büchern eindrücklich dokumentiert. Die Symptome? Diffuse Ängste, Wurzellosigkeit, die Unfähigkeit, sich irgendwo wirklich zugehörig zu fühlen.
Auf Sizilien erlebte ich das Gegenteil. Drei Generationen unter einem Dach, sonntags gemeinsam bei Tisch, die Alten erzählen, die Jungen hören zu. Nicht immer harmonisch, oft laut, aber lebendig. Die Verbindung reißt nicht ab. Bei uns? Schweigen. "Opa war im Krieg." Punkt. Ende der Geschichte.
Hüther sagt noch etwas Wichtiges: "Begeisterung ist wie Dünger fürs Gehirn." Wofür aber sollen wir uns begeistern, wenn unsere eigene Geschichte nur aus zwölf dunklen Jahren zu bestehen scheint? Wenn Bach, Beethoven und Brahms zu "alten weißen Männern" degradiert werden? Wenn selbst das Wanderlied verdächtig ist?
Die Hirnforschung zeigt: Identität braucht positive Anknüpfungspunkte. Stolz – ja, Stolz! – auf Erreichtes ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit für psychische Gesundheit. Kein dumpfer Nationalstolz, sondern das Wissen um die eigenen Wurzeln, die guten wie die schlechten.
"Die Wahrheit wird euch frei machen", heißt es in der Bibel. Auch die Neurowissenschaft bestätigt: Nur was wir anerkennen, können wir integrieren. Nur was wir integrieren, können wir überwinden. Die Deutschen aber durften 75 Jahre lang nicht richtig hinschauen. Nicht auf das Grauen – das wurde ihnen ständig vorgehalten. Sondern auf das Ganze. Auf das, was davor war, was trotzdem war, was danach kam.
Heilung, sagt Hüther, beginnt mit Würdigung. Würdigung dessen, was war. Aller Aspekte. Nur so entsteht Ganzheit. Nur so entsteht Frieden.
VI. Die biblisch-spirituelle Dimension
Jetzt wird's heikel, ich weiß. Religion im öffentlichen Diskurs? Aber bleiben Sie bei mir. Denn die spirituelle Dimension gehört zur deutschen Identität wie der Schwarzwald zu Baden.
"Die Wahrheit wird euch frei machen" (Johannes 8,32) – dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch die deutsche Geistesgeschichte. Luther übersetzte die Bibel, damit jeder selbst lesen konnte. Die deutsche Mystik – Meister Eckhart, Hildegard von Bingen – suchte den direkten Weg zu Gott. "Gott ist in allen Dingen", lehrten sie. Auch in der deutschen Seele?
William Toel, selbst gläubiger Christ, sagt etwas Verstörendes: Teil des Plans von Bletchley Park war, den Deutschen einzureden, Gott habe sie verlassen. Wegen ihrer Schuld seien sie auf ewig verdammt. Eine teuflische Verdrehung der christlichen Botschaft, die eigentlich Vergebung und Neuanfang predigt.
Auf Sizilien sah ich, wie selbstverständlich der Glaube gelebt wird. Nicht bigott, oft oberflächlich, aber präsent. Die Deutschen? "Wir glauben an nichts mehr", sagte mir ein Kollege in Freiburg. "Höchstens an die Wissenschaft." Aber reicht das?
Die Bibel kennt das Konzept der "Sippenhaft" nicht. "Die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben" (Hesekiel 18,20). Warum also tragen wir, die Enkel und Urenkel, immer noch die Last? Warum dürfen wir nicht vergeben – uns selbst, unseren Vorfahren, unserer Geschichte?
"Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden" (Römer 5,20). Das ist kein Freibrief, kein Wegwischen der Schuld. Es ist die Erlaubnis zum Neuanfang. Zur Heilung. Zur Würde.
Die deutsche Seele – ja, ich wage dieses Wort – war immer auch eine suchende Seele. Auf der Suche nach Gott, nach Sinn, nach Wahrheit. Diese Suche wurde uns ausgetrieben. Stattdessen: Konsum, Karriere, Kompensation. Aber die Sehnsucht bleibt.
VII. Die Dringlichkeit des Jetzt
Warum gerade jetzt? Warum sollten wir nach 75 Jahren plötzlich über deutsche Identität sprechen? Die Antwort liegt auf der Hand, wenn man hinschaut.
Unsere Gesellschaft zerfällt. Links gegen Rechts, Jung gegen Alt, Stadt gegen Land. Die Mitte erodiert, die Ränder radikalisieren sich. Wir haben verlernt, miteinander zu reden. Stattdessen: Hass, Häme, Hysterie. Die sozialen Medien wirken wie Brandbeschleuniger.
Aber das ist nur die Oberfläche. Darunter liegt etwas Tieferes: Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Ohne Wurzeln kein Halt. Ohne Identität keine Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft keine Demokratie.
Die Krisen häufen sich. Corona hat gezeigt, wie schnell unsere zivilisatorische Tünche bröckelt. Der Ukraine-Krieg bringt den Krieg zurück nach Europa. Die Energiekrise, die Inflation, die Klimaangst – alles zerrt an unseren Nerven.
In solchen Zeiten suchen Menschen Halt. Finden sie ihn nicht in einer gesunden Identität, suchen sie ihn in Ideologien. Links wie rechts. Die einen träumen vom Öko-Sozialismus, die anderen von der nationalen Wiedergeburt. Beide Wege führen in die Irre.
Was wir brauchen, ist eine dritte Option. Eine Identität, die verwurzelt ist, ohne zu verknöchern. Die stolz ist, ohne überheblich zu sein. Die deutsch ist, ohne andere auszuschließen. Die Geschichte annimmt, ohne in ihr gefangen zu bleiben.
Auf Sizilien lernte ich: Identität ist wie ein Baum. Die Wurzeln müssen tief reichen, sonst fällt er beim ersten Sturm. Aber die Krone muss sich dem Licht entgegenstrecken, sonst verkümmert er. Beides gehört zusammen und erinnert an die berühmte deutsche Eiche.
Die Zeit drängt. Die alten Zeitzeugen sterben. Mit ihnen stirbt die Erinnerung. Nicht nur an das Schreckliche, sondern auch an das Schöne, Gute, Bewahrenswerte. Wenn wir jetzt nicht handeln, ist es für immer verloren.
"Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen", warnte Santayana. Aber wir erinnern uns nur an einen Teil. Den dunklen. Zeit, auch das Licht wieder zu sehen.
Foto KI - Wo gesungen wird, da lass Dich nieder… auch in Lederhosen.
VIII. Wege zur Heilung: Was jeder Einzelne tun kann
Gut, werden Sie sagen. Die Diagnose leuchtet ein. Aber was nun? Was kann ich, Otto Normalverbraucher aus Oberkirch, Lahr oder Offenburg, schon tun? Mehr als Sie denken.
Erstens: Reden Sie mit Ihren Alten. Solange sie noch leben. Fragen Sie nach. Nicht nur nach dem Krieg. Nach der Kindheit, den Festen, den Liedern. Nach dem ganz normalen Leben. Sie werden staunen, was da alles schlummert. Zeichnen Sie es auf. Für Ihre Kinder.
Zweitens: Entdecken Sie Ihre Region neu. Wann waren Sie zuletzt auf der Schauenburg oder dem Schloss Ortenberg? Kennen Sie die Geschichte Ihres Dorfes? Wissen Sie, warum Ihre Straße so heißt, wie sie heißt? Heimatkunde ist nicht peinlich. Sie ist der Anfang von Identität.