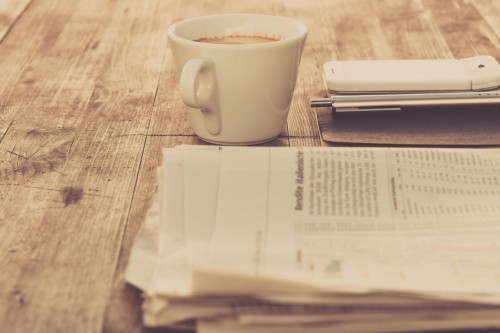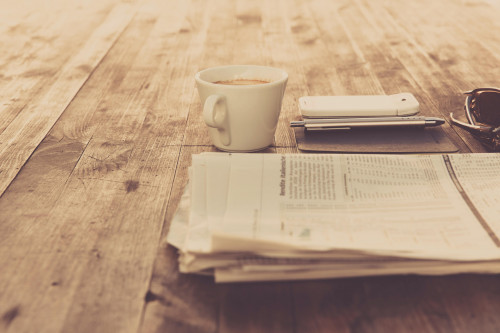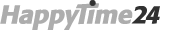NEWS
Palantir: Fluch oder Segen für Deutschland?

Palantir: Fluch oder Segen für Deutschland?
Geschätzte Lesezeit: 9 Minuten
Die umstrittene US-Software zwischen Sicherheitsversprechen und Datenschutzbedenken
Wenn Polizisten mit wenigen Klicks Daten aus verschiedensten Quellen verknüpfen können, klingt das nach moderner Verbrechensbekämpfung. Doch die Software des US-Unternehmens Palantir spaltet Deutschland: Während Sicherheitsbehörden auf mehr Effizienz hoffen, warnen Datenschützer vor dem gläsernen Bürger.
Die Szenen kennen wir aus amerikanischen Krimiserien: Ermittler tippen auf futuristisch anmutenden Bildschirmen herum, Datenströme fließen zusammen, und plötzlich erscheint das gesuchte Muster. Was Hollywood dramatisch inszeniert, wird in deutschen Polizeibehörden zunehmend Realität – allerdings mit einer Software, die heftige Debatten auslöst: Palantir.
Der schillernde Gründer und sein Imperium
Hinter Palantir steht Peter Thiel, ein in Frankfurt geborener Tech-Milliardär, der mit PayPal reich wurde und heute zu den einflussreichsten Figuren des Silicon Valley zählt. Der Trump-Unterstützer hat sich in der Vergangenheit kritisch über Demokratie geäußert und gilt als Förderer des Rechtsrucks in den USA. Sein Unternehmen Palantir, benannt nach den "sehenden Steinen" aus Tolkiens Herr der Ringe, arbeitet seit Jahren für US-Geheimdienste, das Pentagon und zunehmend auch für europäische Behörden.
Die Ironie der Geschichte: Ein Auswanderer aus Deutschland liefert nun die Software, mit der deutsche Behörden ihre Bürger durchleuchten können. Palantir-CEO Alex Karp, ebenfalls ein Thiel-Vertrauter, promovierte einst an der Goethe-Universität Frankfurt über die Kritische Theorie – ausgerechnet jene Denkschule, die vor den Gefahren der instrumentellen Vernunft warnte.
Was kann die Software wirklich?
In Deutschland nutzen bereits Bayern ("VeRA"), Hessen ("Hessendata") und Nordrhein-Westfalen ("DAR") abgespeckte Versionen der Palantir-Software. Das Versprechen: Informationen aus verschiedenen Datenbanken – vom polizeilichen Vorgangssystem über Melderegister bis zum Waffenregister – sollen schneller verknüpft und analysiert werden können.
"Wir verwenden das für besonders schwere Straftaten", betont Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Terrorabwehr, organisierte Kriminalität, Kindesmissbrauch – das sind die offiziellen Einsatzgebiete. Doch die Praxis zeigt ein differenzierteres Bild: Von fast hundert dokumentierten Einsätzen in Bayern zwischen September 2024 und Mai 2025 dienten mehr als zwanzig der Aufklärung von Eigentums- und Vermögensdelikten. "Das kann auch der bandenmäßige Fahrraddiebstahl sein", kritisiert der Grünen-Politiker Benjamin Adjei.
Zwischen Effizienz und Überwachung
Die Befürworter argumentieren pragmatisch: Moderne Kriminalität lasse sich ohne Datenanalyse nicht mehr bekämpfen. "Es ist nicht mehr zeitgemäß, händisch zu arbeiten", sagt BLKA-Projektleiter Jürgen Brandl. Die Software schaffe keine neuen Datensammlungen, sondern verknüpfe nur bereits vorhandene Informationen effizienter.
Datenschützer sehen das anders. "Das Problematische an VeRA ist, dass diese Software massenhaft Menschen in die polizeilichen Datenanalysen einbezieht, die überhaupt keinen Anlass für polizeiliche Ermittlungen gegen sie gegeben haben", warnt der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri. Millionen unbescholtener Bürger könnten so in den Fokus geraten – vom Zeugen einer Straftat bis zum Anrufer bei der Notrufnummer 110.
Die geopolitische Dimension
Die aktuelle Weltlage verschärft die Debatte. In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen stellt sich die Frage: Wie abhängig darf sich Deutschland von amerikanischer Software machen? Die Innenministerkonferenz forderte jüngst eine "digital souveräne Lösung" und warnte vor "Einflussmöglichkeiten außereuropäischer Staaten".
Besonders brisant: In den USA nutzt Palantir seine Technologie zur Aufspürung und Abschiebung illegaler Einwanderer. Die neue Trump-Administration plant einen massiven Ausbau der Überwachungskapazitäten. Was, wenn sich die transatlantischen Beziehungen weiter verschlechtern? Was, wenn amerikanische Interessen plötzlich gegen deutsche Bürgerrechte stehen?
Der Preis des Fortschritts
Deutschland steht vor einem klassischen Dilemma der Moderne: Wie viel Sicherheit wollen wir, und was sind wir bereit, dafür aufzugeben? Die gescheiterten Versuche, eine europäische Alternative zu entwickeln – das Projekt "NASA" wurde nach Jahren ohne Ergebnis eingestellt – zeigen die technologische Abhängigkeit Europas.
"Derzeit gibt es nur eine Software auf dem Markt", räumt das baden-württembergische Innenministerium ein. Diese Alternativlosigkeit macht Palantir zum Quasi-Monopolisten – mit allen damit verbundenen Risiken.
Zwischen Verheißung und Verhängnis
Die Wahrheit über Palantir liegt, wie so oft, in der Mitte. Die Software ist weder der Heilsbringer der Verbrechensbekämpfung noch der Vorbote eines Überwachungsstaates. Sie ist ein mächtiges Werkzeug, dessen Wirkung davon abhängt, wie es eingesetzt wird.
Entscheidend wird sein, ob Deutschland klare rechtliche Grenzen zieht und diese auch durchsetzt. Die Versuchung, ein einmal vorhandenes Instrument auch für weniger schwerwiegende Fälle zu nutzen, ist groß – das zeigen die bayerischen Zahlen. Gleichzeitig kann niemand leugnen, dass moderne Polizeiarbeit ohne digitale Hilfsmittel nicht mehr möglich ist.
Ein Blick in die Zukunft
Was Palantir für Deutschland bedeutet, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Wird es gelingen, die Vorteile der Technologie zu nutzen und gleichzeitig die Grundrechte zu wahren? Oder werden wir eines Tages feststellen, dass wir unsere digitale Souveränität und Privatsphäre für ein Versprechen von mehr Sicherheit geopfert haben?
Die Debatte um Palantir ist mehr als eine technische Diskussion – sie ist ein Lackmustest für unsere Demokratie. Denn am Ende geht es um die Frage, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen: einer, die Sicherheit über alles stellt, oder einer, die auch im digitalen Zeitalter an der Unschuldsvermutung und dem Recht auf Privatsphäre festhält.
Vielleicht sollten wir uns wieder einmal an Erich Kästner erinnern: "Das Leben ist lebensgefährlich." Absolute Sicherheit gibt es nicht – weder mit noch ohne Palantir. Die Kunst besteht darin, die richtige Balance zu finden zwischen dem Schutz vor Gefahren und dem Schutz unserer Freiheit. Diese Gratwanderung ist die eigentliche Herausforderung unserer Zeit.
Postscriptum: Hannah Arendts Warnung
Die Philosophin Hannah Arendt, die selbst vor dem NS-Regime fliehen musste, warnte eindringlich vor den Gefahren der totalen Transparenz. In "Vita Activa" schrieb sie: "Eine Gesellschaft, die sich ganz und gar dem öffentlichen Raum verschrieben hat, beraubt sich der Möglichkeit zur Tiefe."
Arendt erkannte früh, dass Privatsphäre nicht nur ein individuelles Bedürfnis ist, sondern eine Voraussetzung für politische Freiheit. Ohne geschützte Räume, in denen Menschen nachdenken, zweifeln und sich entwickeln können, verliert eine Gesellschaft ihre Fähigkeit zur kritischen Reflexion. Die totale Durchleuchtung, so Arendt, führe nicht zu mehr Sicherheit, sondern zur Konformität aus Angst.
Ihre Analyse des Totalitarismus zeigt erschreckende Parallelen zu heutigen Überwachungstechnologien: Die Macht moderner Systeme liegt nicht in spektakulärer Gewalt, sondern in der stillen Erfassung und Kategorisierung von Menschen. Was Arendt die "Banalität des Bösen" nannte – die gedankenlose Ausführung von Befehlen in bürokratischen Apparaten – findet heute sein Echo in Algorithmen, die ohne moralisches Bewusstsein Muster erkennen und Menschen klassifizieren.
Besonders bedenkenswert ist Arendts Beobachtung, dass totalitäre Systeme nicht mit dem erklärten Ziel der Unterdrückung beginnen, sondern mit dem Versprechen von Ordnung und Sicherheit. Die schleichende Gewöhnung an Überwachung, die schrittweise Ausweitung von Befugnissen – all das sind Mechanismen, die sie in ihrer Analyse des Totalitarismus beschrieb.
Vielleicht sollten wir Palantir auch durch Arendts Brille betrachten: Nicht als isolierte Technologie, sondern als Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung, die unsere Vorstellungen von Privatheit, Freiheit und Menschenwürde fundamental herausfordert. Ihre Mahnung bleibt aktuell: Eine Demokratie, die ihre Bürger vollständig durchleuchtet, hört auf, eine Demokratie zu sein – auch wenn sie sich weiterhin so nennt.
23.07.2025, Andreas Peter Geng (apg), Freier Journalist, Mitglied im DJV